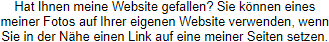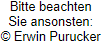Landwirte im
Fichtelgebirge
Oberfranken
Landwirtschaft im Nebenerwerb
Kleinbäuerliches Leben
im modernen 20. Jahrhundert
Meine Kindheit
auf dem Bauernhof
Im 2. Weltkrieg und in den Jahren danach, als in den großen Städten die Menschen hungerten und froren, hatte das Landleben in der Kleinstadt und auf dem Dorf durchaus Vorteile. Auch Handwerker hatten meist ein paar Kühe im Stall, Schweine und Hühner. Wenn man was anderes brauchte, konnte man eine Büchse Pressack oder a Schräitl G'reicherts (ein Stück Räucherfleisch, ein Schrötlein) zum Tausch anbieten.
Die meisten hatten auch ein paar Tagwerk Wald (1 Tagewerk entspricht 3408 m² oder ca. ein Drittel Hektar), der zu Brennholz wurde. Obwohl ein paar Kühe schon fast das ganze Haus heizen, brauchte man Brennmaterial, da früh und abends zwei Riesentöpfe Kartoffeln für die Schweine auf dem Ofen kochten. Und das Essen wurde im Gegensatz zu heute lange und weich gekocht, damit die Großeltern ohne Zähne auch was davon hatten. Ob die Schnitz mit backna Glees (Gemüseeintopf) gut waren, maß man an der Anzahl und der Größe der Fettaugen, die darauf herumschwammen. Heute schöpft man die ab und schmeißt sie weg.
 Wildpark Hundshaupten oder in
Wildpark Hundshaupten oder in  Kleinwendern bei Bad Alexandersbad, das von der
Kleinwendern bei Bad Alexandersbad, das von der  Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) als Arche-Dorf zertifiziert ist. Hier gibt es noch das Sechsämter Rotvieh, eine Unterart des Roten Höhenviehs, einer Rinderrasse, die schon auf die Kelten zurückgeht, oder das Coburger Fuchsschaf bei Schirnding.
Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) als Arche-Dorf zertifiziert ist. Hier gibt es noch das Sechsämter Rotvieh, eine Unterart des Roten Höhenviehs, einer Rinderrasse, die schon auf die Kelten zurückgeht, oder das Coburger Fuchsschaf bei Schirnding.
Die Wagen und Maschinen, die eine Deichsel und Befestigungen für's Kuh-Geschirr hatten, mussten auf den Betrieb mit dem Traktor umgestellt werden. Kein Problem, denn unser Nachbar, der Neupert's Rudi, hatte eine Landmaschinen-Werkstatt. Er nahm auch schon mal die Abkürzung und stieg durchs Fenster direkt in unseren Garten. Die Sähmaschine verlor die vorderen Räder, die ja nicht mehr gebraucht wurden und jetzt als Spielzeug für uns Kinder dienten.
Um den Kartoffeln einen Vorsprung vor dem Unkraut zu verschaffen, musste ein Teil Erde rund um die Pflanzen ständig bearbeitet werden, deshalb nennt man sie auch Hackfrüchte, wie auch die Rüben. Zunächst wurden die Beete mit einer speziellen hölzernen Egge mit eisernen Zähnen oo-g'schlicht' (abgeeggt). Dann wurde die Erde mit einem Pflug wieder noa-g'ackert (hingeackert, angehäufelt), später von dem Beet wieder weeg-g'ackert (weggeackert) und wiederum später wieder noa-g'ackert (rangeackert). Die Oberseite der Beete, zwischen den Kartoffelpflanzen, konnte man mit der Maschine nicht mehr erreichen, weshalb das Erdepflfeld ausgeputzt werden musste, nichts anderes als Unkraut jäten mit einer Hacke. Nach einem abschließendem Anhäufeln mit dem Vielfachgerät boten die Erdepfl-Pflanzen dann endlich genug Schatten, um sich gegen das Unkraut durchzusetzen.
 Die Mutter lief auf dem Feld herum und band die Wischla zu Garben zusammen. Manchmal mit Strohbändern, später immer mehr mit dunkel lila gefärbten Schnüren aus Hanf oder Sisal. Lila waren sie, weil man sie dann später auf dem düsteren Kornboden in dem Gewirr von Halmen besser sehen konnte. Aus Pflanzenfasern waren sie, weil es schon mal vorkam, dass eine Kuh sie mitfraß. Sie hat sie dann einfach verdaut. Das Stroh wurde nämlich nicht nur im Stall eingestreut, sondern zum Teil auch gehäckselt und diente, vermischt mit den in der Stopfmaschine zerkleinerten Rüben, als Futter. Auf einer Seite hatte jede Schnur ein Hölzchen, um welches das andere Ende geschlungen wurde. So erhielt man eine Art Knoten, der leicht wieder zu öffnen war, und so konnten die Schnüre jedes Jahr wiederverwendet werden.
Die Mutter lief auf dem Feld herum und band die Wischla zu Garben zusammen. Manchmal mit Strohbändern, später immer mehr mit dunkel lila gefärbten Schnüren aus Hanf oder Sisal. Lila waren sie, weil man sie dann später auf dem düsteren Kornboden in dem Gewirr von Halmen besser sehen konnte. Aus Pflanzenfasern waren sie, weil es schon mal vorkam, dass eine Kuh sie mitfraß. Sie hat sie dann einfach verdaut. Das Stroh wurde nämlich nicht nur im Stall eingestreut, sondern zum Teil auch gehäckselt und diente, vermischt mit den in der Stopfmaschine zerkleinerten Rüben, als Futter. Auf einer Seite hatte jede Schnur ein Hölzchen, um welches das andere Ende geschlungen wurde. So erhielt man eine Art Knoten, der leicht wieder zu öffnen war, und so konnten die Schnüre jedes Jahr wiederverwendet werden.
Die Wischla wurden zu Kornmännla aufgestellt, damit sie nicht über Nacht die Bodenfeuchte aufnahmen und schön trocken blieben oder trocken wurden. Dafür stellte man sie möglichst locker aneinander, damit der Wind hindurchwehen konnte. Auf diese Weise ergaben sich praktische Häuschen für uns Kinder zum Verstecken und drin wohnen. Dass einem die Grannen des Getreides in den Nacken fallen und die Ganze Nacht jucken können, was soll's, »Schäi war's!« (Schön war's!).
So bald meine Beine lang genug waren, um Kupplung und Bremse des Traktors zu erreichen, durfte ich beim Aufladen von Haufen zu Haufen fahren. Der Vater spießte die Wischla mit der Gabel auf den Wagen und die Mutter ordnete sie oben so, dass am Schluss der verzurrte Wieschbaam (Haltebaum für die Garben) in der Mitte alle halten konnte.
An manchen Stellen standen die Halme des Getreides nicht mehr, sondern es lag auf dem Boden. Oft geschah das durch Gewitter, Starkregen, Hagel oder Sturm. Auf dem Boden liegend blieb es feucht, war schlecht zu ernten und die Körner waren von minderer Qualität. Selten gab es durch kleine Windwirbel auch kreisförmige Inseln liegenden Getreides. Wahrscheinlich waren das die Vorläufer der Kornkreise, die heute von UFO-Jüngern als Zeichen von Außerirdischen gedeutet oder als Streich angelegt werden. Früher war es die Sagengestalt des Bilmesschneiders, der heimlich das Getreide abschnitt.
Unglaublich, wie viele Räder sich drehten, wenn sich das Ganze in Bewegung setzte, und wie viele kleinere Riemen wieder andere Räder antrieben, auch wieder alles ohne Schutzbleche etc. »Pass auf, dass' di niat neizejht!« (Pass auf, dass es dich nicht reinzieht). Ein Gebläse blies die Söid oder Sejd (= Spreu: Samenhüllen, Spelzen, Grannen und Stängelteile) durch ein dickes Rohr in einen Raum der Strohschupfm, eine sehr stachelige Angelegenheit, aber zusammen mit Rübenschnitzeln fraßen das tatsächlich die Kühe! Deshalb nennt man sie auf beamtendeutsch auch "Raufutter verzehrende Großvieheinheit".
Sich hin und her bewegende Siebe ließen kleine Unkrautsamen herausfallen, und das Getreide wurde in normale und große Körner sortiert. Die Großen waren für die Saat nächstes Jahr. Die anderen fielen in Säcke, die am Sackhalter hingen.
Das Getreide wurde vom Korn-Buadn (Getreideboden) durch das Zejluach (Ziehloch), das senkrecht über drei Stockwerke reichte, nach unten geworfen und landete auf dem Dreschwagen, wo die Mutter nach und nach die Dreschwelle damit fütterte, nicht zu viel auf einmal, sonst blockierte die, es gab beängstigende Geräusche, der Riemen sprang herab und schlängelte sich durch den Schwung manchmal noch wie eine große Schlange. Der Dreschwagen spuckte das gedroschene Getreide als Stroh wieder aus, das im Hof gestapelt und zwischengelagert wurde. Erst wenn eine Seite des Bodens bis zum hintersten Wischl leer war, konnte man am Abend das Stroh mit einem Seil über einer Umlenkrolle wieder nach oben ziehen. Machte man eine Schlaufe und setzte sich hinein, konnte man durch Zug am anderen Ende des Seils sich selbst nach oben ziehen. Mein Onkel Georg soll dabei als Kind einmal abgestürzt sein, hat's aber überlebt.
Anfang der 60er Jahre bekamen wir eine moderne Strohpresse direkt an den Ausgang des Dreschwagens. Sie presste das Stroh zu quaderförmigen Büscheln und erzeugte Knoten mit einer Schleife, die sich aber im Gegensatz zu den Schuhband-Schleifen nicht öffnen ließen. Ich habe versucht, an meinen Schuhbändern die gleichen Schleifen nachzumachen, hab's aber nicht geschafft. Der Nachteil des gepressten Strohs war, dass man es nicht mehr als Strohhalm zum Seifenblasenmachen verwenden konnte.
Die meisten hatten auch ein paar Tagwerk Wald (1 Tagewerk entspricht 3408 m² oder ca. ein Drittel Hektar), der zu Brennholz wurde. Obwohl ein paar Kühe schon fast das ganze Haus heizen, brauchte man Brennmaterial, da früh und abends zwei Riesentöpfe Kartoffeln für die Schweine auf dem Ofen kochten. Und das Essen wurde im Gegensatz zu heute lange und weich gekocht, damit die Großeltern ohne Zähne auch was davon hatten. Ob die Schnitz mit backna Glees (Gemüseeintopf) gut waren, maß man an der Anzahl und der Größe der Fettaugen, die darauf herumschwammen. Heute schöpft man die ab und schmeißt sie weg.
Kühe
Am nützlichsten waren die Kühe. Sie zogen den Pflug, den Wagen oder schon so manche Maschine. Früh und abends gaben sie Milch und wenn sie alt wurden, kam der Viehhändler oder gleich der Metzger selbst. Heute nennt man das Dreinutzungsrinder. Kälbchen gab's auch noch jedes Jahr eins als Dreingabe. An das Ackern mit Kühen habe ich nur noch verschwommene Erinnerungen. Die Kommandos hießen bei uns nicht Hüh und Hot für Links und Rechts, sondern Hot und Wista (oder Wister). Zum Loslaufen hieß es Hiah (entspricht wohl dem Hü). Dreinutzungsrassen gibt es nicht nur bei Kühen (Milch, Fleisch und Zugtiere), sondern auch bei Schafen (Wolle, Milch, Fleisch). Heutzutage sind Rinder spezialisiert, zum Beispiel Hochleistungs-Milchkühe mit Riesen-Eutern oder Fleisch-Rinder, die nur für den Metzger gezüchtet und gefüttert werden. Zugtiere werden garnicht mehr gebraucht.Alte Nutztierrassen
werden verschiedentlich in Wildparks, Naturparks oder Freilichtmuseen für die Nachwelt erhalten, wie zum Beispiel imEin Traktor
Schon in meinem vierten Lebensjahr bekamen wir einen Traktor, einen luftgekühlten Deutz mit sage und schreibe 13 PS. Es herrschte Aufbruchstimmung im beginnenden Wirtschaftswunder. Er musste in Selb abgeholt werden. Die Straße war damals noch enger und mit vielen Straßenbäumen. Statt reflektierender Begrenzungspfosten waren weiße Rechtecke mit Ölfarbe auf die Baumstämme gemalt. Auf der Spielberger Höh', einem Höhenrücken zwischen Selb und Marktleuthen, rauchte ein Rad und stank bestialisch. Wir warteten auf ein Fahrzeug Richtung Selb und ließen dem Verkäufer ausrichten, dass wir nicht weit gekommen waren. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam in der Gegenrichtung ein Fahrzeug, dessen Fahrer uns ausrichtete, wir sollten es wieder probieren, wenn die Bremse kalt ist. Sie war wohl etwas zu knapp eingestellt, aber beim zweiten Versuch geht’s dann meistens. So war es auch.Die Wagen und Maschinen, die eine Deichsel und Befestigungen für's Kuh-Geschirr hatten, mussten auf den Betrieb mit dem Traktor umgestellt werden. Kein Problem, denn unser Nachbar, der Neupert's Rudi, hatte eine Landmaschinen-Werkstatt. Er nahm auch schon mal die Abkürzung und stieg durchs Fenster direkt in unseren Garten. Die Sähmaschine verlor die vorderen Räder, die ja nicht mehr gebraucht wurden und jetzt als Spielzeug für uns Kinder dienten.
Kühe mit Fuhrwerk und offenem Joch (Rinderkummet)  Foto: Harald Stark
Foto: Harald Stark
Das Geschirr für Kühe
Ein Stirnblatt des Geschirrs wurde meine Schaukel. Kühe zogen bei uns nämlich die Lasten mit der Stirn, hartnäckig! Auf dem Bild ganz oben ist das deutlich zu sehen, offizielle Bezeichnung lautet Stirneinzeljoch. Ein geschlossenes Joch, ein Kummet, wie bei Pferden, kann man nicht anlegen wegen der Hörner und dem dicken Kopf. Andere hatten für Kühe auch sogenannte Rinderkummets oder Kumts, die oben ein Scharnier haben und unten zu öffnen sind. Dadurch kann man sie von oben aufstecken, an den Hörnern vorbei (zweites Bild). Die Zugkraft wird damit nicht von der Stirn, sondern von Brust und Schultern übertragen.Klauenbeschneider
Erstaunt war ich, als nun ab und zu ein Klauenbeschneider vorbeikam und den Kühen die Zehennägel, die Hufe, schnitt. Da sie nur noch im Stall standen, wurden die nämlich nicht mehr abgenutzt.Besamer
Wenn sie mal Lust auf einen Stier bekamen, was man daran merkte, dass sie einen ableckten, und dass der Schwanz zur Seite geht, wenn man auf den Rücken drückt, kam kein Stier, sondern der Besamer. Warum dieser vor der eigentlichen Besamung bis zum Anschlag ins After greift und alles rausholt, was da drin ist, hat mir keiner erklärt, »Fräig niat sua dumm!« (Frag nicht so dumm!). Heute weiß ich, dass der Besamer mit dem zweiten Arm im geleerten Mastdarm dafür sorgt, dass er das Besamungsinstrument genau im Gebärmutterhals positionieren kann. Auf diese Weise kommt man mit sehr wenig Sperma aus und kann viele Kühe mit einem „Schuss“ des Stiers besamen.Getreide säen
Jede Jahreszeit hatte ihre Herausforderungen, und wir Kinder durften schon kräftig mitarbeiten. Bei der Sähmaschine musste man hinterherlaufen und wenn sich ein Grasstück oder altes Erdepfl-Kreitere (Kartoffel-Kraut) zwischen den Säh-Rohren verfing, trat man während der Fahrt drauf, und schon war es weg. Mit ein bisschen Übung geht das prima. Wenn man mit dem Hosenbein irgendwo hängenblieb, zog's einem die Füße weg, in dem weichen Ackerboden fiel man aber weich. Zur Unfallverhütung gab's den Satz: »Pass auf, dass'd niat mit'n Huasabaa hängableibst!« (Pass auf, dass du nicht mit dem Hosenbein hängenbleibst!). Die Menge des Saatgetreides pro Flächeneinheit konnte an der Sämaschine eingestellt werden. Säte man das Getreide zu dicht, schossen die Halme schlank und dünn nach oben und wurden bei Wind umgeworfen. Bei der Ernte lag das Korn dann und die Körner konnten nicht trocknen. Im schlimmsten Fall verpilzten die Körner und mussten auf den Misthaufen oder sie keimten bei Nässe bereits auf dem Halm und für ausgewachsenes Getreide gabs nur wenig Geld.Heuernte
Bei der Heuernte durfte ich auf dem großen Rechen sitzen, auf einem eisernen Sitz ohne Geländer, »Halt de fei gout fest!« (Halt dich gut fest!), und an bestimmten Stellen einen Fußhebel betätigen. Dann hob sich der Rechen und entließ das Heu in einer großen Walze. Macht man das immer wieder an der gleichen Stelle nebeneinander, entsteht ein Mohn (ich nehme an, das kommt von Mähne). Der wird dann mit dem umgekehrten Handrechen zu Heuhaufen zusammengeschoben. Ist das Heu schön trocken, geht das prima und man hat schnell einen Riesenhaufen, in den man springen kann, und das Heu dadurch wieder verteilt, »Mach kaan Bleedsinn!« (Mach keinen Blödsinn!).Die Erdäpfel (Kartoffeln)
Bis in den Juni hinein machten die Kartoffeln viel Arbeit. Um 1960 bekamen wir von der Verwandtschaft in Pilgramsreuth ein ausgemustertes Vielfachgerät. Ein geniales System. An einem am Traktor angebrachten Gestell konnten verschiedene Arbeitsgeräte montiert werden. Auf dem gedüngten, geackerten und geeggten Feld machte es zunächst Furchen und in einem Rutsch Löcher für die Saatkartoffeln. Die musste man von Hand verteilen. Dann wurden sich drehende Scheiben angebracht, welche die gelegten Erdepfel mit Erde bedeckten. Am schrägen Hang des Galgenbergs musste die Mutter hinterherlaufen und die Pflugschare lenken, sonst gab's Chaos und keine geraden Furchen und Beete.Um den Kartoffeln einen Vorsprung vor dem Unkraut zu verschaffen, musste ein Teil Erde rund um die Pflanzen ständig bearbeitet werden, deshalb nennt man sie auch Hackfrüchte, wie auch die Rüben. Zunächst wurden die Beete mit einer speziellen hölzernen Egge mit eisernen Zähnen oo-g'schlicht' (abgeeggt). Dann wurde die Erde mit einem Pflug wieder noa-g'ackert (hingeackert, angehäufelt), später von dem Beet wieder weeg-g'ackert (weggeackert) und wiederum später wieder noa-g'ackert (rangeackert). Die Oberseite der Beete, zwischen den Kartoffelpflanzen, konnte man mit der Maschine nicht mehr erreichen, weshalb das Erdepflfeld ausgeputzt werden musste, nichts anderes als Unkraut jäten mit einer Hacke. Nach einem abschließendem Anhäufeln mit dem Vielfachgerät boten die Erdepfl-Pflanzen dann endlich genug Schatten, um sich gegen das Unkraut durchzusetzen.
Getreideernte
Im August war für mich das größte Wunderwerk der Technik die Haumaschine. Sie schnitt das Getreide ab, das erst mal auf einen „Tisch“ fiel und dadurch gesammelt wurde. Vier hölzerne Rechen kreisten in der Luft und man konnte mit einem Hebel einstellen, ob jeweils jeder zweite, jeder dritte, oder jeder vierte Rechen die Halme vom Tisch wischte und damit ein Wischl Korn auf dem Feld hinterließ. Neben dem großen Rad war ein Sitz (ganz rechts im Bild), von dem der Hebel erreichbar war, selbstverständlich alles ohne Schutzblech oder Sicherheitseinrichtungen, »Pass auf, dass' di niat neileiert!« (Pass auf, das es dich nicht hineindreht!). Die Halterungen der Rechen liefen auf Rollen auf einer Bahn, und wenn einer ein Wischl vom Tisch streichen sollte, klappte eine kleine Weiche auf und der Rechen senkte sich dazu nach unten in eine tiefere Bahn. Stundenlang habe ich der Mechanik zugeschaut und versuchte zu ergründen, wie das funktioniert, »Traam niat, mach dou gräißere Wischla!« (Träum nicht, mach hier größere Garben!). Je nachdem, ob das Korn nämlich dicht oder schütter stand, konnte man mit dem Hebel steuern, dass die Wischla etwa gleichgroß wurden. Sie mussten ja später aufgeladen und daheim im Ziehloch auf den Getreideboden gezogen, dann zum Dreschen wieder nach unten geschmissen und anschließend das Stroh wieder nach oben gezogen werden.
Kornmännla (Puppen) auf einem Getreidefeld
Die Wischla wurden zu Kornmännla aufgestellt, damit sie nicht über Nacht die Bodenfeuchte aufnahmen und schön trocken blieben oder trocken wurden. Dafür stellte man sie möglichst locker aneinander, damit der Wind hindurchwehen konnte. Auf diese Weise ergaben sich praktische Häuschen für uns Kinder zum Verstecken und drin wohnen. Dass einem die Grannen des Getreides in den Nacken fallen und die Ganze Nacht jucken können, was soll's, »Schäi war's!« (Schön war's!).
So bald meine Beine lang genug waren, um Kupplung und Bremse des Traktors zu erreichen, durfte ich beim Aufladen von Haufen zu Haufen fahren. Der Vater spießte die Wischla mit der Gabel auf den Wagen und die Mutter ordnete sie oben so, dass am Schluss der verzurrte Wieschbaam (Haltebaum für die Garben) in der Mitte alle halten konnte.
An manchen Stellen standen die Halme des Getreides nicht mehr, sondern es lag auf dem Boden. Oft geschah das durch Gewitter, Starkregen, Hagel oder Sturm. Auf dem Boden liegend blieb es feucht, war schlecht zu ernten und die Körner waren von minderer Qualität. Selten gab es durch kleine Windwirbel auch kreisförmige Inseln liegenden Getreides. Wahrscheinlich waren das die Vorläufer der Kornkreise, die heute von UFO-Jüngern als Zeichen von Außerirdischen gedeutet oder als Streich angelegt werden. Früher war es die Sagengestalt des Bilmesschneiders, der heimlich das Getreide abschnitt.
Kartoffelernte (Erdepflgrobm)
Im Herbst wurden die Erdäpfl mit dem Schleiderer (Erdschleuder) aus dem Boden geholt und mussten dann aufgeklaubt werden. Das war keine so schöne Arbeit, aber als Entschädigung gab's die Erdepflfeierla (Kartoffelfeuer). In der Glut kohlschwarz gegarte Erdepfl schmecken im Innern unvergleichlich. Man musste nur den richtigen Zeitpunkt zum Herausholen erwischen, sonst waren sie Kohle. Auch heute mach ich das noch ab und zu im Garten in meinem Lagerfeuer.Rübenernte
Im Oktober kamen die Rüben dran, »Des is kaa Arbat für eich Kinner!« (Das ist keine Arbeit für euch Kinder!). Der Strunk und die Wurzeln wurden mit einem großen Messer abgeschlagen und die Rüben grob gesäubert. Die Eltern machten sich wahrscheinlich sorgen, dass dabei mal ein Finger der Kinder auf der Strecke bleiben könnte. Bei dieser Herbstarbeit haben oft schon die Hände gebitzelt vor Kälte.Das Dreschen
Danach, meist schon im November, kam nochmal ein Highlight. Die hauptberuflichen Bauern hatten in der Scheunenzeile der Neudeser Gasse in Marktleuthen fest eingebaute Dreschanlagen. Diese wurden nur einmal im Jahr gebraucht, nahmen aber ständig viel Platz weg. Wir hatten einen modernen Dreschwagen. Er wurde in die Tenne geschoben, und ein vier PS starker Elektromotor, der über eine Transmission auch andere Maschinen wie den Häcksler antrieb, drehte über einen langen Lederriemen die Dreschwelle, »Immer schäi Räamapeech draaf!« (Riemenpech verhindert das Durchrutschen des Riemens).Unglaublich, wie viele Räder sich drehten, wenn sich das Ganze in Bewegung setzte, und wie viele kleinere Riemen wieder andere Räder antrieben, auch wieder alles ohne Schutzbleche etc. »Pass auf, dass' di niat neizejht!« (Pass auf, dass es dich nicht reinzieht). Ein Gebläse blies die Söid oder Sejd (= Spreu: Samenhüllen, Spelzen, Grannen und Stängelteile) durch ein dickes Rohr in einen Raum der Strohschupfm, eine sehr stachelige Angelegenheit, aber zusammen mit Rübenschnitzeln fraßen das tatsächlich die Kühe! Deshalb nennt man sie auf beamtendeutsch auch "Raufutter verzehrende Großvieheinheit".
Sich hin und her bewegende Siebe ließen kleine Unkrautsamen herausfallen, und das Getreide wurde in normale und große Körner sortiert. Die Großen waren für die Saat nächstes Jahr. Die anderen fielen in Säcke, die am Sackhalter hingen.
Das Getreide wurde vom Korn-Buadn (Getreideboden) durch das Zejluach (Ziehloch), das senkrecht über drei Stockwerke reichte, nach unten geworfen und landete auf dem Dreschwagen, wo die Mutter nach und nach die Dreschwelle damit fütterte, nicht zu viel auf einmal, sonst blockierte die, es gab beängstigende Geräusche, der Riemen sprang herab und schlängelte sich durch den Schwung manchmal noch wie eine große Schlange. Der Dreschwagen spuckte das gedroschene Getreide als Stroh wieder aus, das im Hof gestapelt und zwischengelagert wurde. Erst wenn eine Seite des Bodens bis zum hintersten Wischl leer war, konnte man am Abend das Stroh mit einem Seil über einer Umlenkrolle wieder nach oben ziehen. Machte man eine Schlaufe und setzte sich hinein, konnte man durch Zug am anderen Ende des Seils sich selbst nach oben ziehen. Mein Onkel Georg soll dabei als Kind einmal abgestürzt sein, hat's aber überlebt.
Anfang der 60er Jahre bekamen wir eine moderne Strohpresse direkt an den Ausgang des Dreschwagens. Sie presste das Stroh zu quaderförmigen Büscheln und erzeugte Knoten mit einer Schleife, die sich aber im Gegensatz zu den Schuhband-Schleifen nicht öffnen ließen. Ich habe versucht, an meinen Schuhbändern die gleichen Schleifen nachzumachen, hab's aber nicht geschafft. Der Nachteil des gepressten Strohs war, dass man es nicht mehr als Strohhalm zum Seifenblasenmachen verwenden konnte.
Der Getreideboden (Traadbuadn)
War die Getreidernte in eine feuchte Zeit gefallen, mussten die schweren Säcke mit den Körnern durch das Ziehloch bis in den obersten Spitzboden gezogen werden. Dort wurden die Körner zum Trocknen aufgeschüttet. Deshalb hieß dieser auch Traadbuadn (Getreideboden). Dann das Ganze wieder umgekehrt, rein in Säcke, runterlassen, und ab zur Mühle oder verkauft ans Lagerhaus. Irgendwann entfiel diese Arbeit für das verkaufte Getreide, weil das Lagerhaus Freude & Pirner am Eckenmühlweg in einer Scheune eine Getreidetrocknung gebaut hatte. Dort drehte sich eine riesige Trommel, die von unten mit Gasflammen beheizt wurde. Allerdings war der Verkaufspreis für feuchtes Getreide geringer, »Wir zahlen doch nicht für das Wasser im Korn!«. Der Hafer wurde gelagert und als Hühnerfutter verwendet.Die Mühlen
Das andere Mehl holte man ein paar Tage später von der Mühle, brachte es zum Bäcker und erhielt dafür Brotmarken. Schaffte man das Mehl zum Elbel am Unteren Markt, musste man darauf achten, dass es auf der Eckenmühle gemahlen war. Mehl von der Finkenmühle (Neudorfer Mühle) erkannte die Frau Elbel als solches, indem sie hineinfasste und es zwischen den Fingern verrieb, und nahm es nicht an. Der Knielings-Beck im Heffagleesviertel nahm beides.Das Mutterkorn
Alle Bäcker schauten allerdings genau hin, denn winzige kleine schwarze Pünktchen in dem weißen Mehl wiesen auf einen Befall des Roggens mit dem Mutterkornpilz hin. Das Mutterkorn, ein schwarzer Auswuchs an der Ähre, enthält giftige Alkaloide, welche besonders oft im Mittelalter das Antoniusfeuer verursachten, eine schwere, manchmal tödliche Krankheit, benannt nach Antonius von Koma (251 bis 356), welcher der Schutzpatron gegen den Ergotismus war, die Mutterkornvergiftung. Er verbrachte einen großen Teil seines Lebens als Asket in der ägyptischen Wüste.Aus dem Mutterkornpilz extrahierte der Chemiker Albert Hofmann 1938 Lysergsäure. Das daraus hergestellte Medikament Lysergsäurediethylamid zur Kreislauf-Anregung wurde 30 Jahre später in der Hippie-Szene als das Halluzinogen, Psychedelikum, Rauschmittel und die bewusstseinserweiternde Droge LSD bekannt.
Die Waldarbeit
Kettensäge hatten wir natürlich keine. Das lohnte sich damals noch nicht. Während man heute Kettensägen im Angebot schon unter 100 Euro bekommt, war das damals noch eine Investition. Mit der Handsäge, meist eine Bogensäge oder Bügelsäge, geht's auch. Für dickere Bäume kam die Zwei-Mann-Säge zum Einsatz, bei uns meist die Mann-und-Frau-Säge, Mutter und Vater. Beim Schärfen (Seechfaaln, Sägefeilen) daheim, erklärte mir mein Vater, dass die Zähne der Zwei-Mann-Sägen symmetrisch gefeilt werden müssen, damit die Säge in jede Richtung sägt, im Gegensatz zur Bogensäge, wo die Zähne schräg sind. Von der Waldarbeit blieb ich jedoch meist verschont, zu gefährlich, zu schwer.«Holz macht drei mal warm!« Das alte Sprichwort stimmt:
- Beim Holzfällen im Wald und Aufladen
- Zu Hause beim Zerkleinern: Sägen, Hacken, Aufschlichten
- Beim Reintragen, Einschüren, und dann endlich der Ofen
Selbst mit den Kettensägen, einer großen für den Stamm, einer leichten zum Ausasten, ist das keine leichte Arbeit, geht aber viel schneller.
Zu Hause hatten wir eine große Kreissäge, die mit einem Lederriemen von der Riemenscheibe unseres Traktors angetrieben wurde. Montiert auf einem selbstgebauten Holzgestell, natürlich alles ohne Schutzbleche oder ähnliche Schutzvorrichtungen, die behindern ja nur! Ich durfte auf dem Traktor sitzen, und Gas geben, wenn sich die 13 PS bei dicken Stämmen manchmal schwer taten.
Traf es damals nur die kleinen Bauern, dehnt sich das Sterben der Bauernhöfe auf immer größere Betriebe aus. Großbauern von 1960 sind heute als Kleinbetriebe fast nicht mehr lebensfähig! Die Industrialisierung der Landwirtschaft mag man beklagen, aber anders sind die 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde nicht mehr zu ernähren. Und jedes Jahr werden es 70 Millionen mehr! Bevölkerungswachstum und Überbevölkerung, das Grundproblem unserer Zeit!
Bevölkerungswachstum und Überbevölkerung, das Grundproblem unserer Zeit!
Wir hatten noch Glück, denn mein Vater war hauptberuflich Schreiner, und die Landwirtschaft war nur Nebenverdienst, aber viele Kleinbauern konnten nicht verstehen, dass ihre Arbeit nichts mehr wert war, und sind daran zerbrochen. Noch heute denke ich mit Schwermut an die Zeit zurück, auch während ich diese Zeilen geschrieben habe.
 Biedermeierkleidung, wie Fremdkörper in einer anderen Welt. Mit ihrer noblen, unpraktischen Kleidung mussten sie von der Wildnis auch einen gewissen Abstand halten. Eine etwas realistischere Darstellung pflegte
Biedermeierkleidung, wie Fremdkörper in einer anderen Welt. Mit ihrer noblen, unpraktischen Kleidung mussten sie von der Wildnis auch einen gewissen Abstand halten. Eine etwas realistischere Darstellung pflegte  Carl Spitzweg
Carl Spitzweg  . Bauern malte er aber meines Wissens auch nicht. Sie waren nicht Teil dieser Land-Romantik. Sie kamen nicht vor.
. Bauern malte er aber meines Wissens auch nicht. Sie waren nicht Teil dieser Land-Romantik. Sie kamen nicht vor.
Für den Einsatz großer landwirtschaftlicher Maschinen sind natürlich größere Felder ohne Hindernisse erforderlich, aber Anfang des 21. Jahrhunderts setzt sich langsam die Überzeugung durch, dass man es damit nicht übertreiben darf. Begradigte Flüsse erzeugen Hochwasser an den Unterläufen, ausgeräumte Landschaften Erosion, Monokulturen großflächige Schädlingsprobleme, etc. Heute hat man eine gute Ausrede: Man schiebt einfach alle Natur-Katastrophen auf den Klimawandel, teilweise zwar richtig, oft aber auch nur Sündenbock.
Klimawandel, teilweise zwar richtig, oft aber auch nur Sündenbock.
Was den Schutz natürlicher Lebensräume angeht, hat allerdings im 21. Jahrhundert schon ein gewisses Umdenken stattgefunden. Renaturierung und die Zulassung von Überschwemmungsflächen an den Flüssen, und der Waldumbau zu mehr Mischwäldern, sind erste Hoffnungsschimmer. Ob sich angesichts steigender Bevölkerungszahlen geschützte Flächen dauerhaft sichern lassen, erscheint zweifelhaft, und die Möglichkeit, Lebensmittel in Zukunft synthetisch herstellen zu können, nicht gerade einladend.
Die Wiesen wurden allerdings weniger wegen der Trockenheiten bewässert. Es handelte sich um sogenannte Wässerwiesen. Da es damals noch keine Kläranlagen gab, hatte das Wasser der Eger auch eine gute düngende Wirkung! Besonders im 19. Jahrhundert wurde die Wiesenbewässerung stark ausgebaut und Bau, Reparatur und Verwaltung oft in Genossenschaften oder von der Gemeinde geregelt. Heute gelten solche historische Anlagen als Kulturgut und man versucht sie als Kulturdenkmal zu erhalten, wie hier im Itztal
Itztal
Auch die Eckenmühle hatte einen Bewässerungsgraben, der vom Mühlgraben abzweigte und die Wiesen Richtung Marktleuthen bewässern konnte. Ebenso fiel mir auf der alten Karte von ca. 1860 auf, dass der Rohrsbach damals weit entlang der heutigen Bahnhofstraße Richtung Osten umgeleitet wurde und sicher auch die darunter liegenden Wiesen in der Paint (Point) bewässern konnte.
 Eger. Und nach Anstrengungen half Abschwitzen und Katzenwäsche.
Eger. Und nach Anstrengungen half Abschwitzen und Katzenwäsche.
Aber alles hat seine zwei Seiten: Desinfektionsmittel helfen gegen Wundinfektionen, früher half dagegen auch mal ein starker Schnaps (äußerlich angewendet). Natriumnitrit (Nitritpökelsalz) verhindert zum Beispiel in Rohwurst und rohem Fleisch, dass Bakterien Botulinumtoxin (BTX) erzeugen. Lebensmittelvergiftungen durch verdorbenes Fleisch wurden dadurch viel seltener. Leider findet man heute Nitritpökelsalz auch in Lebensmitteln, die gegart sind oder erhitzt werden, sogar in Konservendosen, völlig unnötig. Bei unseren Hausschlachtungen wurde Pressack auch in Dosen gefüllt und diese im Kessel gekocht. Der Pressack im Darm oder in der Schweinsblase wurde geräuchert. Niemand kam auf die Idee, zum Pressack Pökelsalz hinzuzufügen. Heute findet man dieses sogar in den Pressack-Büchsen vom Hausmetzger. Nicht weil's erforderlich wäre, sondern weil das Fleisch dann "schön rot" aussieht.
Ein gesundes Immunsystem braucht ein gewisses Maß an Training, also Kontakt mit Bakterien oder Viren. Das gilt vermutlich auch für die Corona-Viren. Für gesunde Menschen ist eine regelmäßige Aufnahme von geringen Mengen COVID-19-Viren möglicherweise besser als ständige Desinfektion, Abstand und Isolation. Anders ist es bei Festen und Feiern, wo es so laut und eng zugeht, dass man sich vor Krach gegenseitig anschreien muss, wenn man den Gesprächspartner verstehen will. Da bekommt man eine volle Viren-Ladung ab, und wenn das Immunsystem diese nicht kennt, passiert sowas wie am Anfang beim Après-Ski in Ischgl oder dem Karneval im Kreis Heinsberg.
Corona-Viren. Für gesunde Menschen ist eine regelmäßige Aufnahme von geringen Mengen COVID-19-Viren möglicherweise besser als ständige Desinfektion, Abstand und Isolation. Anders ist es bei Festen und Feiern, wo es so laut und eng zugeht, dass man sich vor Krach gegenseitig anschreien muss, wenn man den Gesprächspartner verstehen will. Da bekommt man eine volle Viren-Ladung ab, und wenn das Immunsystem diese nicht kennt, passiert sowas wie am Anfang beim Après-Ski in Ischgl oder dem Karneval im Kreis Heinsberg.
Der Niedergang der Kleinbauern
Zur gleichen Zeit setzte eine Entwicklung ein, die hauptberuflichen Kleinbauern sehr zusetzte und manche in die Armut trieb. Alles was man kaufte, wurde immer teurer, die verkauften landwirtschaftlichen Produkte allerdings brachten immer weniger ein. Ende der 60er Jahre mussten wir die Landwirtschaft nach und nach aufgeben, da es sich nicht mehr lohnte, und nie werde ich das Gefühl vergessen, als wir die letzte Kuh verkauften und ich dann ab und zu den leeren Stall betrat, in dem immer so viel Leben geherrscht hatte, und jetzt nur noch dunkle gähnende Leere. Bis heute denke ich oft an die Zeit der kleinen Landwirtschaft zurück und mir kommt das Motto von Bilbo Beutlins Geschichte aus dem Herrn der Ringe in den Sinn: »Es ist nicht das Schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen!«Traf es damals nur die kleinen Bauern, dehnt sich das Sterben der Bauernhöfe auf immer größere Betriebe aus. Großbauern von 1960 sind heute als Kleinbetriebe fast nicht mehr lebensfähig! Die Industrialisierung der Landwirtschaft mag man beklagen, aber anders sind die 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde nicht mehr zu ernähren. Und jedes Jahr werden es 70 Millionen mehr!
Wir hatten noch Glück, denn mein Vater war hauptberuflich Schreiner, und die Landwirtschaft war nur Nebenverdienst, aber viele Kleinbauern konnten nicht verstehen, dass ihre Arbeit nichts mehr wert war, und sind daran zerbrochen. Noch heute denke ich mit Schwermut an die Zeit zurück, auch während ich diese Zeilen geschrieben habe.
In Dankbarkeit an meine Eltern,
die von früh bis spät mit schwerer Arbeit dafür sorgten,
dass ich nie hungern und frieren musste.
 Fotoalbum
Fotoalbum
die von früh bis spät mit schwerer Arbeit dafür sorgten,
dass ich nie hungern und frieren musste.
Romantik des Landlebens
Als Anfang des 19. Jahrhunderts Caspar David Friedrich und Carl Friedrich Lessing ihre romantischen Bilder von urtümlichen Landschaften, Wäldern und Bäumen malten, zog es wohlsituierte Stadtbürger mit ihrer Sehnsucht nach Natürlichkeit und Landlust hinaus aufs Land. Es fand eine Art Idealisierung und Verklärung der Wildnis statt. Dabei wirken die Stadtmenschen in den Gemälden, oft inKulturpessimismus
Über 50 Jahre später, 1930, schriebSigmund Freud
zur Zurück-zur-Natur-Bewegung in seinem Werk Das Unbehagen in der Kultur: »Wir leiden an der sogenannten Kultur, wir glauben, dass wir in primitiveren, natürlicheren Verhältnissen glücklicher wären. Dabei wissen wir nicht, ob die Menschen, die früher in solchen Verhältnissen lebten, tatsächlich glücklicher waren.« Dem Kulturpessimismus war er schon Jahrzehnte vorher verfallen. Wahrscheinlich hatte er in seinem Leben zu viel Kontakt zu gescheiterten Existenzen. Das färbt ab. So schrieb er auch: »Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten.«Flur-Bereinigung
Begünstigt und ermöglicht durch die Maschinen wurden im 20. Jahrhundert die natürlichen romantischen Landschaften durch Ordnung ersetzt. Flüsse hatten gerade zu verlaufen, Bäume als Monokulturen in Reih und Glied zu stehen, nicht bearbeitete Flächen galten als unnütz, Wildpflanzen als zu vernichtendes Unkraut, aus Mischwäldern wurden Fichten-Plantagen. Das gipfelte in Flussbegradigungen, Heckenrodungen, Monokulturen und der Flurbereinigung, bis in den 1970er Jahren die Umweltbewegung die negativen Seiten dieser übermäßigen Eingriffe in die Natur aufzeigte.Für den Einsatz großer landwirtschaftlicher Maschinen sind natürlich größere Felder ohne Hindernisse erforderlich, aber Anfang des 21. Jahrhunderts setzt sich langsam die Überzeugung durch, dass man es damit nicht übertreiben darf. Begradigte Flüsse erzeugen Hochwasser an den Unterläufen, ausgeräumte Landschaften Erosion, Monokulturen großflächige Schädlingsprobleme, etc. Heute hat man eine gute Ausrede: Man schiebt einfach alle Natur-Katastrophen auf den
Was den Schutz natürlicher Lebensräume angeht, hat allerdings im 21. Jahrhundert schon ein gewisses Umdenken stattgefunden. Renaturierung und die Zulassung von Überschwemmungsflächen an den Flüssen, und der Waldumbau zu mehr Mischwäldern, sind erste Hoffnungsschimmer. Ob sich angesichts steigender Bevölkerungszahlen geschützte Flächen dauerhaft sichern lassen, erscheint zweifelhaft, und die Möglichkeit, Lebensmittel in Zukunft synthetisch herstellen zu können, nicht gerade einladend.
Wässerwiesen
Unterhalb des Pfarr-Rangens bei den Rinnwiesen (nördlich des heutigen Fußballplatzes) gab es Bewässerungsgräben, bei denen früher auf die Stunde genau festgelegt war, wer wann und wie lange seine Wiesen bewässern durfte und wer wieviel für Instandsetzungen der Gräben zu leisten hatte.1 Und ich dachte, Trockenheit wäre ein neues Phänomen!Die Wiesen wurden allerdings weniger wegen der Trockenheiten bewässert. Es handelte sich um sogenannte Wässerwiesen. Da es damals noch keine Kläranlagen gab, hatte das Wasser der Eger auch eine gute düngende Wirkung! Besonders im 19. Jahrhundert wurde die Wiesenbewässerung stark ausgebaut und Bau, Reparatur und Verwaltung oft in Genossenschaften oder von der Gemeinde geregelt. Heute gelten solche historische Anlagen als Kulturgut und man versucht sie als Kulturdenkmal zu erhalten, wie hier im
Auch die Eckenmühle hatte einen Bewässerungsgraben, der vom Mühlgraben abzweigte und die Wiesen Richtung Marktleuthen bewässern konnte. Ebenso fiel mir auf der alten Karte von ca. 1860 auf, dass der Rohrsbach damals weit entlang der heutigen Bahnhofstraße Richtung Osten umgeleitet wurde und sicher auch die darunter liegenden Wiesen in der Paint (Point) bewässern konnte.
Hygiene
Zu viel Hygiene kann schaden, das hört man in letzter Zeit immer wieder. Menschen, die auf dem Bauernhof in natürlicher, unhygienischer Umgebung aufgewachsen sind, sollen weniger an Allergien leiden und ein besseres Immunsystem haben. Desinfektionsmittel töten eben auch das gute Mikrobiom auf der Haut. Und die Darmflora kommt nicht nur durch Antibiotika durcheinander, sondern auch durch die verschiedensten Lebensmittelzusätze und Konservierungsmittel. Ein Kontakt mit den Ausscheidungen der Tiere war damals unvermeidlich, Kuhmist, Schweinemist und Hühnermist allgegenwärtig und ein guter Dünger. Kuhfladen und Pferdeäpfel sammelten manche von der Straße, als Dünger für den Garten oder sogar für Blumentöpfe. Einmal pro Woche baden war die Regel, dazu gab es das Volksbad im Keller des Schulhauses, eine Wanne in der Schreinerwerkstatt oder im Sommer ein Bad in derAber alles hat seine zwei Seiten: Desinfektionsmittel helfen gegen Wundinfektionen, früher half dagegen auch mal ein starker Schnaps (äußerlich angewendet). Natriumnitrit (Nitritpökelsalz) verhindert zum Beispiel in Rohwurst und rohem Fleisch, dass Bakterien Botulinumtoxin (BTX) erzeugen. Lebensmittelvergiftungen durch verdorbenes Fleisch wurden dadurch viel seltener. Leider findet man heute Nitritpökelsalz auch in Lebensmitteln, die gegart sind oder erhitzt werden, sogar in Konservendosen, völlig unnötig. Bei unseren Hausschlachtungen wurde Pressack auch in Dosen gefüllt und diese im Kessel gekocht. Der Pressack im Darm oder in der Schweinsblase wurde geräuchert. Niemand kam auf die Idee, zum Pressack Pökelsalz hinzuzufügen. Heute findet man dieses sogar in den Pressack-Büchsen vom Hausmetzger. Nicht weil's erforderlich wäre, sondern weil das Fleisch dann "schön rot" aussieht.
Ein gesundes Immunsystem braucht ein gewisses Maß an Training, also Kontakt mit Bakterien oder Viren. Das gilt vermutlich auch für die
Ältere Landwirtschaft
In dem Bild von Adam Friedrich Zürner, dem Hofgeographen Augusts des Starken, das Bäuerliche Arbeiten um 1740 zeigt, erkenne ich vieles wieder, das sich bis ins 20. Jahrhundert hinein kaum verändert hatte. Erst ab diesem Jahrhundert fanden rasante gravierende Veränderungen statt. Die hölzernen Rechen, das Dengeln der Sensen ganz rechts, das ständige Nachschärfen beim Mähen mit einem mitgeführten Schleifstein (dahinter), die Egge, die Leinen- oder Jutesäcke, der hölzerne Schubkarren (halb verdeckt, bei uns die Ro-Warrm). Trotz der Modernisierung in den 50er Jahren war vieles davon noch vorhanden, auch wenn die Ro-Warrm durch einen metallenen Schubkarren ersetzt wurde.Moderne Zeiten
Nicht weit von unserem Haus gab es einen Lebensmittelladen, der einer Frau Freude gehörte, aber jeder sagte dazu "die Herrle". Schon als kleines Kind durfte ich für meine Mutter dort einkaufen, wenn sie nur wenig brauchte, das ich mir merken konnte. Man musste ja nur sagen, was man brauchte, dann bekam man das. Eines Tages sagte meine Mutter zu mir "Gäihst za da Herrle und kaafst a Sterkmöll".Damals war das Lebensmittelgeschäft gerade auf Selbstbedienung umgestellt worden, etwas ganz modernes! Kein Problem für mich, konnte ich doch schon lesen, und dass "Sterkmöll" Stärkemehl heißt, konnte ich mir auch denken. Ich ging um das einzige Verkaufsregal in dem kleinen Geschäft herum und suchte danach. Nach der dritten Runde war ich mir sicher, dass es keines gab, und ging zur Kasse um zu fragen. »Natürlich gibt's des«, sagte die Frau Freude, beschrieb mir, wo es steht und wandte sich wieder ihrer Gesprächspartnerin zu, mit der sie offenbar ein sehr wichtiges Gespräch führte. Ich war mir sicher, dass ich sie richtig verstanden hatte, und dass ich am richtigen Platz war, aber da gab es kein Stärkemehl, ganz sicher.
Ich schaute zurück zur Kasse und sah die beiden Frauen lachten. Da bekam ich den Verdacht, dass ich die Ursache für das Gelächter war. Aber was blieb mir anderes übrig, als nochmal hinzugehen. Sie gaben mir zu verstehen, dass ich keine Ahnung hätte, denn da steht natürlich Kartoffelmehl drauf! Dass man aus Kartoffeln auch Mehl machen kann, war mir neu. Daheim fragte meine Mutter ungeduldig, wo ich denn so lange gewesen war, und ich erzählte ihr, dass ich es nicht gleich gefunden hätte. Man lernt eben nie aus, auch wenn man schon in der 2. Klasse ist!
Moderne Landwirtschaft
Mit der oben beschriebenen Kleinbäuerlichen Landwirtschaft können wir die Weltbevölkerung von demnächst 8 Milliarden Menschen nicht ernähren.
Heute, im 21. Jahrhundert, sehen sich unsere Bauern vermehrt Kritik ausgesetzt. Große Felder ohne Feldraine, Chemieeinsatz, Kunstdünger und Massentierhaltung werden kritisiert, meist von Leuten, die noch nie auf einem Bauernhof gearbeitet haben. 1950 hat ein Landwirt mit seiner Arbeit ca. vier Menschen ernährt. Heute sind es etwa 140. Ein Zurück gibt es nicht!
Wirtschaftliche Zwänge, Bürokratie, emotionale dogmatische Vorwürfe
Ein Bauer unterliegt allerdings heute vielen verschiedenen Zwängen. Ein Wust von Gesetzen und Bürokratie regelt (behindert) die tägliche Arbeit von früh bis spät. Die Bauern müssen von ihrer Arbeit leben können, unternehmerisch handeln, und mit Investitionen und Ausgaben in Höhe von Hunderttausenden von Euro rechnen. Sie brauchen die Unterstützung der Politik und nicht immer mehr Einschränkungen und Vorschriften. Das erinnert mich an eine Legende aus dem Elsass:Alternativvorschläge werden meist emotional, ideologisch und dogmatisch von Leuten propagiert, die nie einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt und in der Landwirtschaft bestenfalls mal in einem Ferienjob gearbeitet haben. Die historischen Arbeitsweisen waren aus heutiger Sicht ineffizient, und so lange Milliarden von Haustieren mit Hundefutter und Katzenfutter aus Fleisch gefüttert werden, kann man die Leute auch nicht dazu bringen, Vegetarier zu werden. Wenn in Familien Vater und Mutter von früh bis spät arbeiten müssen, um die Miete oder die Hypotheken-Raten zu bezahlen, kann man ihnen nicht vorwerfen, abends beim Discounter zu billigen Fertig-Lebensmitteln zu greifen, statt jeden Tag zu einem Markt zu gehen um Bio-Gemüse zu kaufen und den halben Abend zu schnippeln und zu kochen.
Andere Lösungen sind utopisch: Die Rückführung der Weltbevölkerungszahl auf 500 Millionen, wie im Mittelalter, oder das Fleisch aus dem Chmielabor und dem 3D-Drucker? Uns bleibt nur, moderne landwirtschaftliche Arbeitsweisen vorsichtig zu verbessern und dabei nicht zu vergessen, dass auch industriell hergestellte Lebensmittel irgendwo auf einem Feld wuchsen oder in einem Stall herangefüttert wurden.
Den Bauern, die diese Arbeit Tag für Tag leisten,
gebührt unser Respekt und unsere Anerkennung!
gebührt unser Respekt und unsere Anerkennung!
Wirklichkeitsfremde Darstellungen und Angriffe
In einem Buch von1 Jürgen Menzel, Rußbuttenträger Nr. 14 von 1992, Seite 219
Bitte beachten Sie:
© 2020 von Erwin Purucker
© 2020 von Erwin Purucker
Einen zum Freilichtmuseum umgebauten historischen Bauernhof können Sie hier erleben:
Historische landwirtschaftliche Geräte und vieles mehr finden Sie im
Bücher über Landwirtschaft
Bücher:
 Peter Rosegger - Als ich noch der Waldbauernbub war
Peter Rosegger - Als ich noch der Waldbauernbub war
 Waldheimat von Peter Rosegger
Waldheimat von Peter Rosegger
Die Kindsmagd - Aus dem Leben meiner Großmutter
von Bärbel Kießling, Marktredwitz
Bärbel Kießling, Marktredwitz
Fotos, Bilder, Gemälde,
Poster, Wohnaccessoires:
 Landschaften
Landschaften
 Berge
Berge
 Landleben
Landleben
 Romantik
Romantik
 Carl Friedrich Lessing
Carl Friedrich Lessing
 Caspar David Friedrich
Caspar David Friedrich
 Carl Spitzweg
Carl Spitzweg
Die Kindsmagd - Aus dem Leben meiner Großmutter
von
Fotos, Bilder, Gemälde,
Poster, Wohnaccessoires: